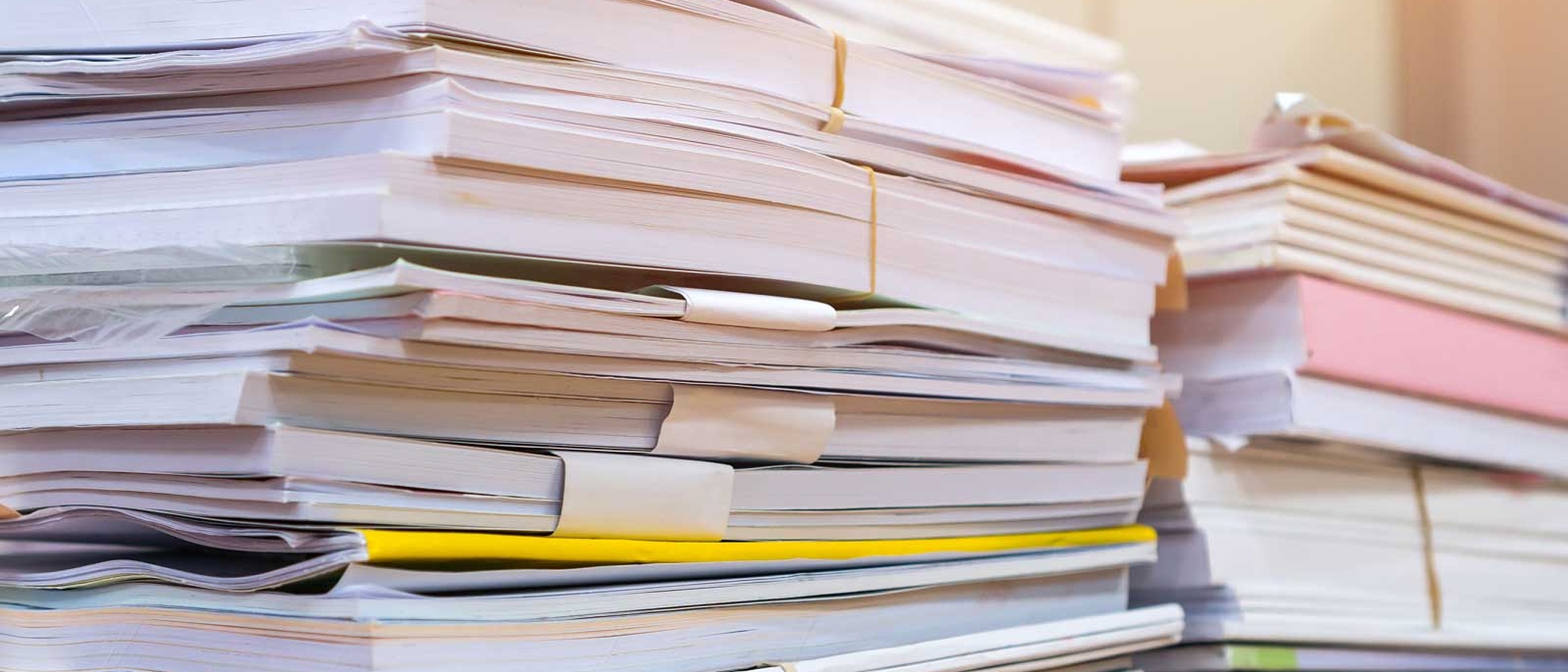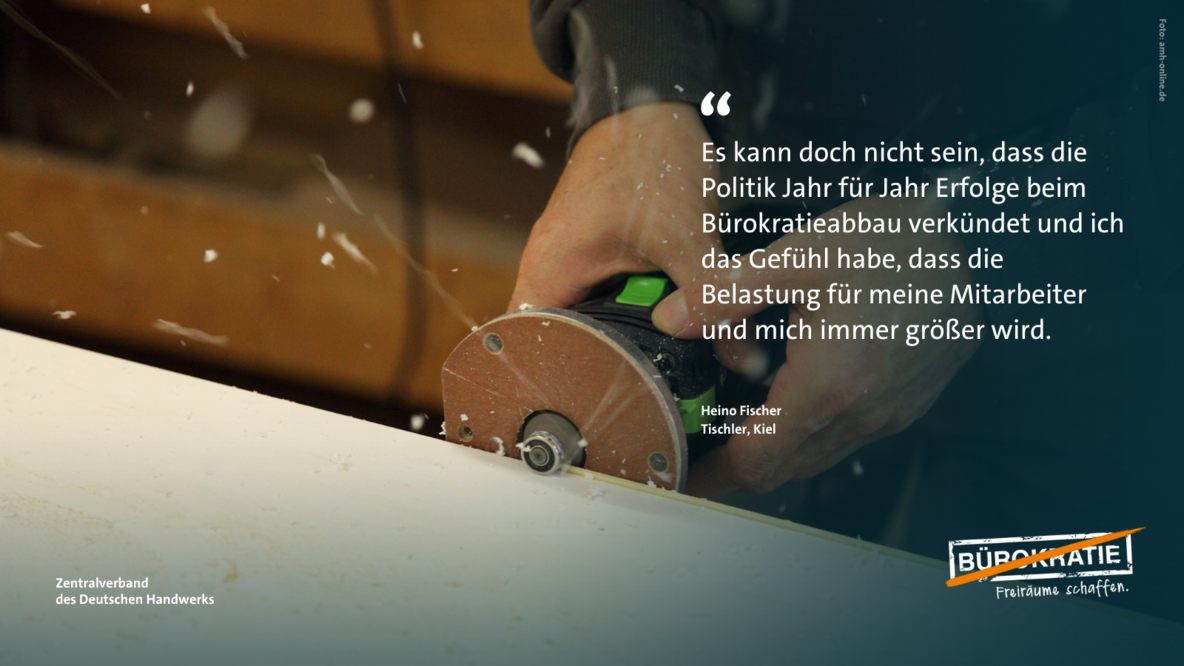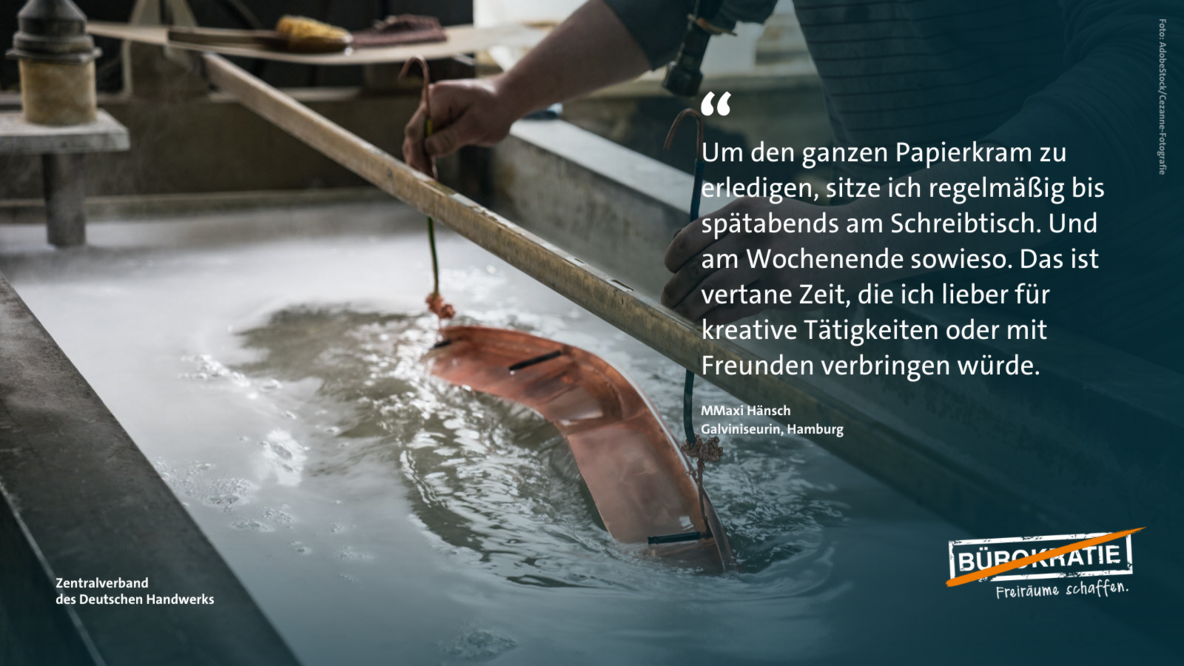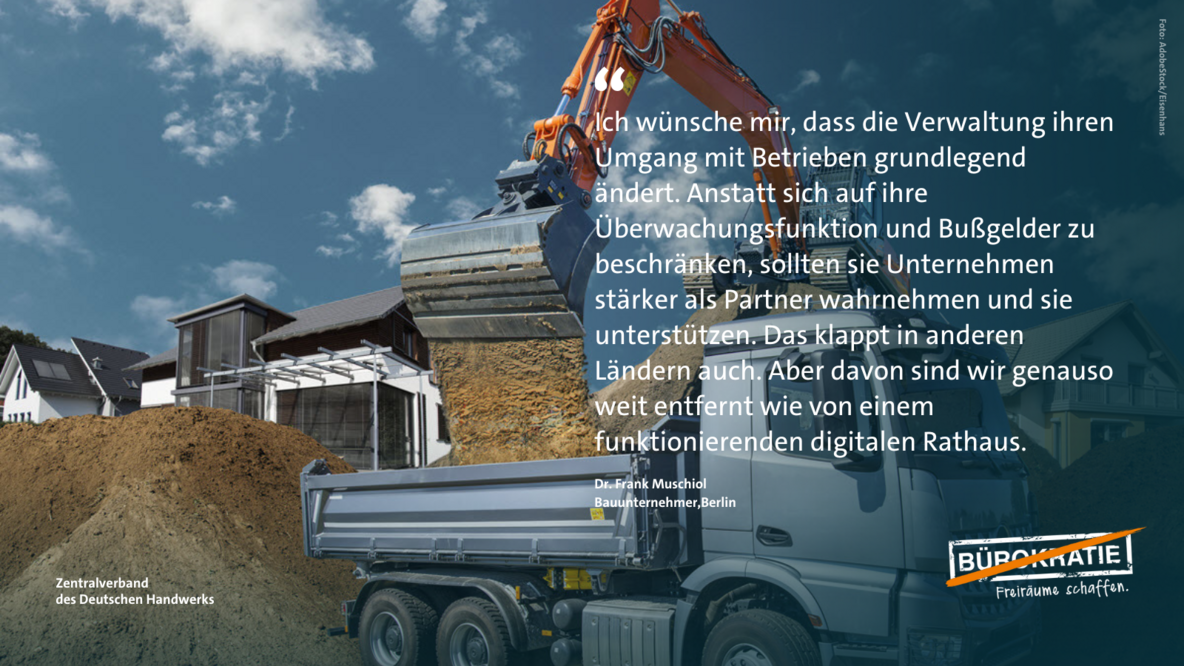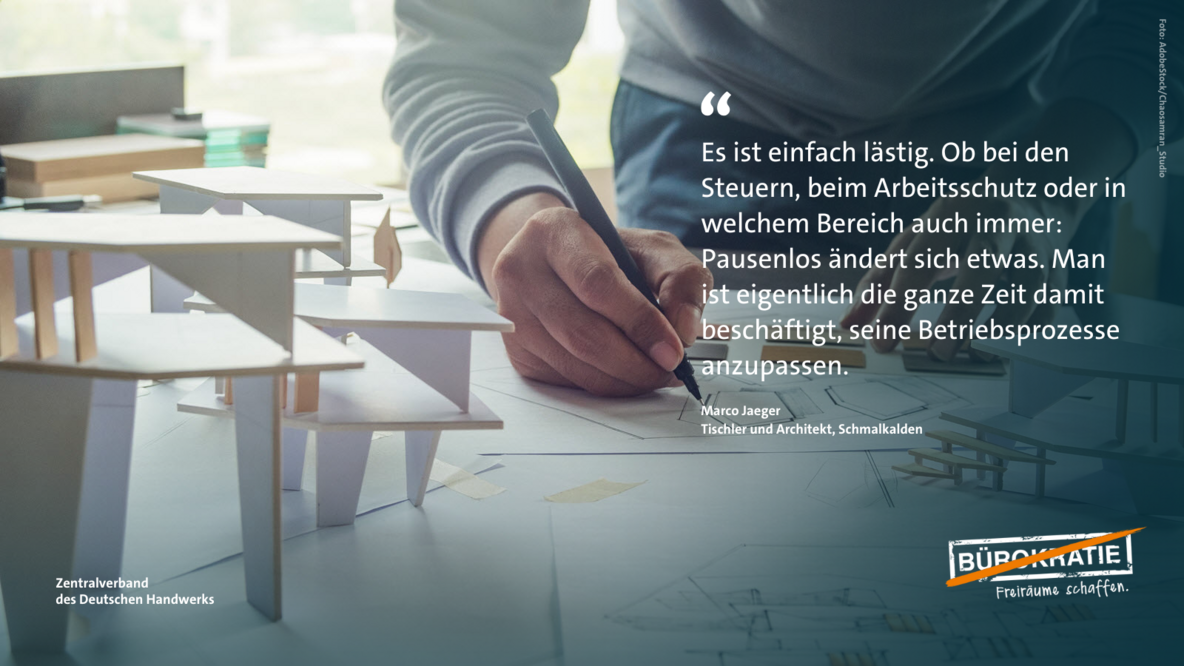Maßnahmenmonitor Bürokratieabbau
Die Bundesregierung greift mit zahlreichen, konkreten Entlastungsmaßnahmen im Koalitionsvertrag langjährige Forderungen des Handwerks auf und setzt damit die richtigen Akzente. Nun kommt es darauf an, diese schnell und konsequent umzusetzen.
Unser Maßnahmenmonitor gibt einen Überblick über die entsprechende Umsetzung der in Aussicht gestellten Entlastungen. Den Stand der Umsetzung können Sie auf der Rückseite der jeweiligen Kacheln entnehmen ("angekündigt" / “in Bearbeitung” / “umgesetzt”).
Sofortprogramm für den Bürokratierückbau
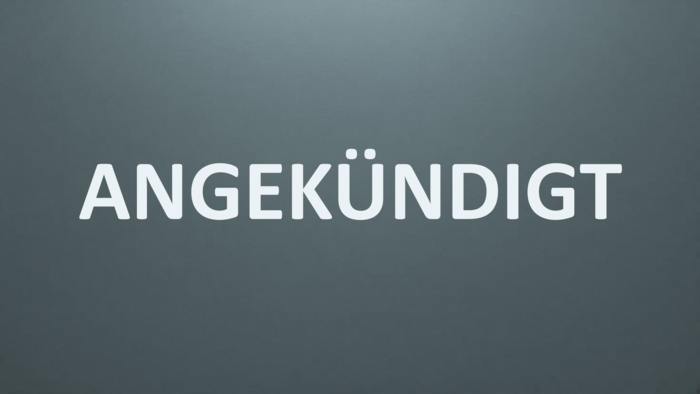
Berichtspflicht nach nationalem LkSG
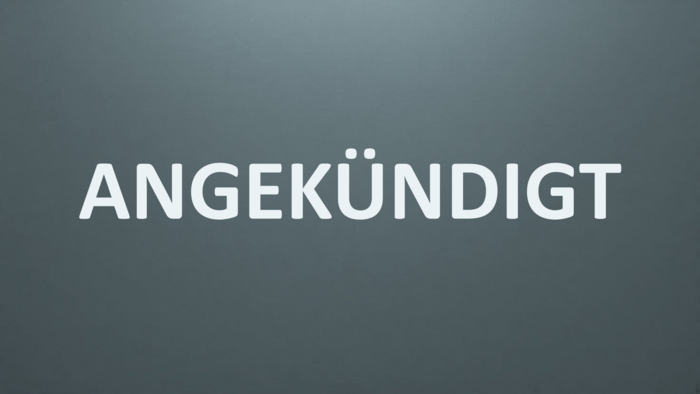
Energieeffizienzgesetz und Energiedienstleistungsgesetz
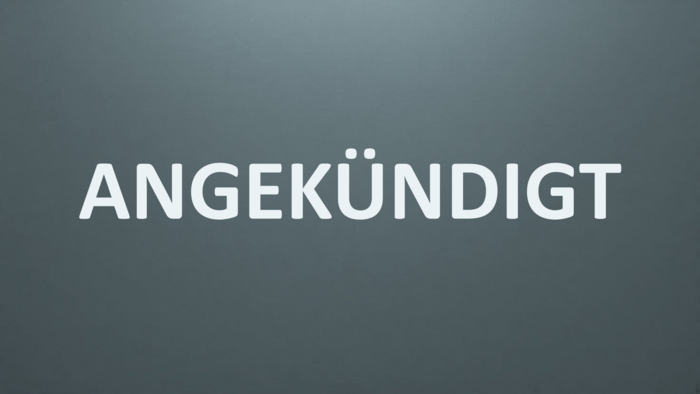
Bonpflicht
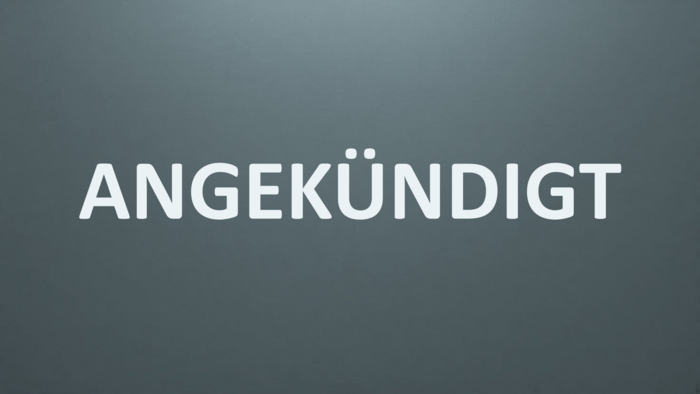
Verwaltungsvorschriften
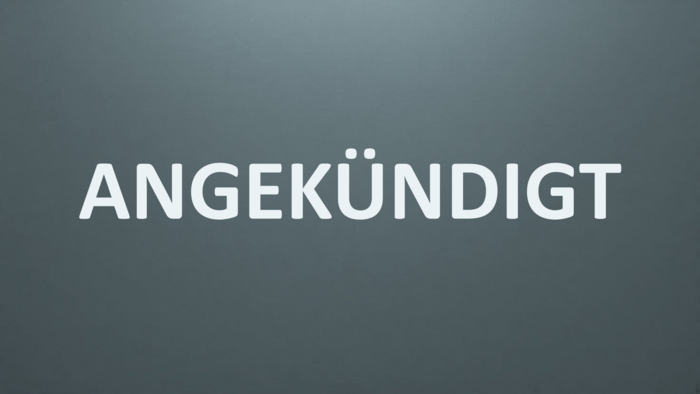
Statistikpflichten
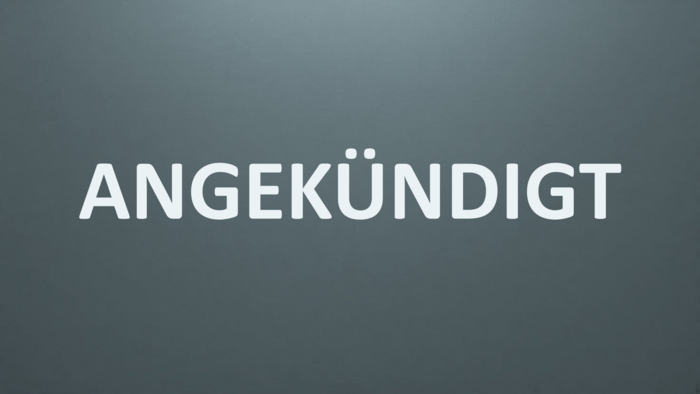
Bürokratiekosten und Erfüllungsaufwand senken
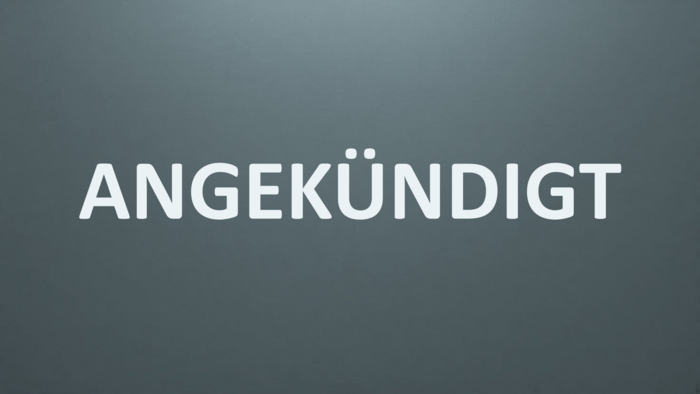
Jährliches Bürokratierückbaugesetz
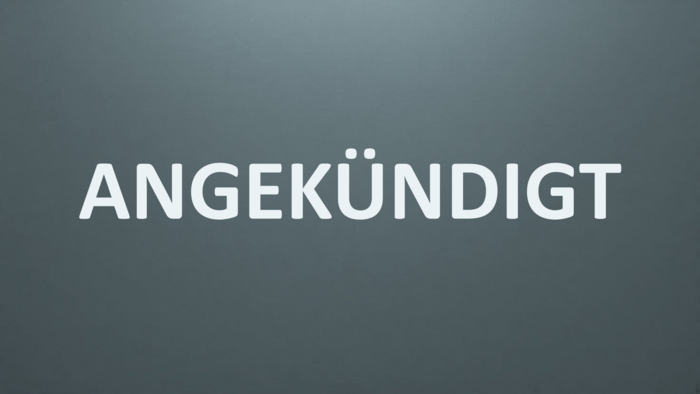
Fachrechtlicher Bürokratierückbau
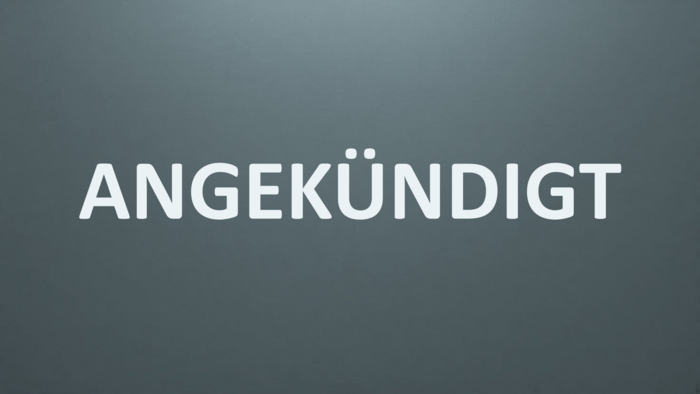
Praxischecks Ministerien
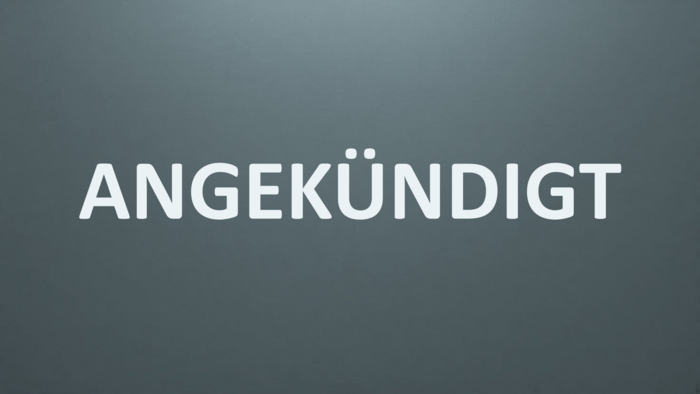
Berichtspflichten
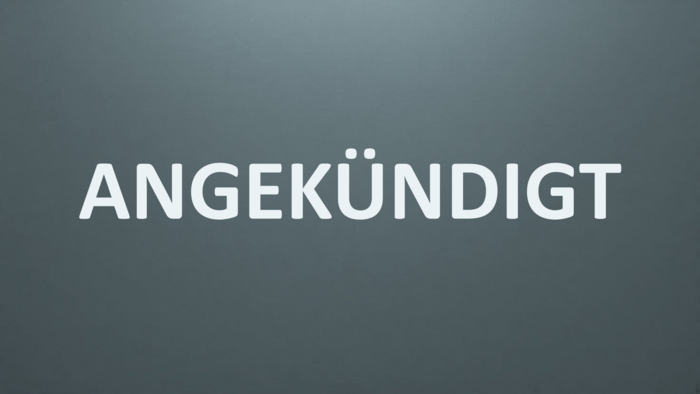
"One in, two out"
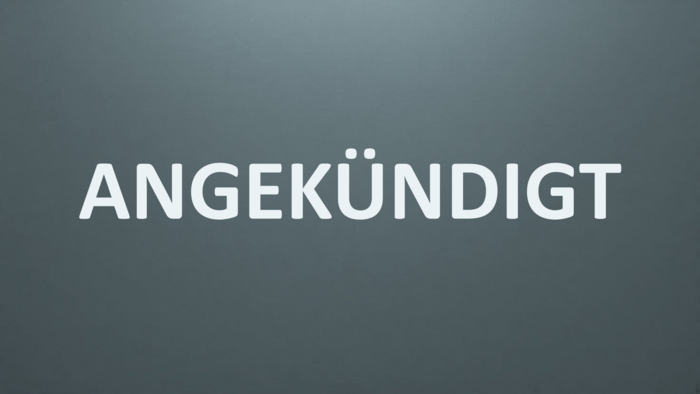
Praxischecks Gesetzgebung
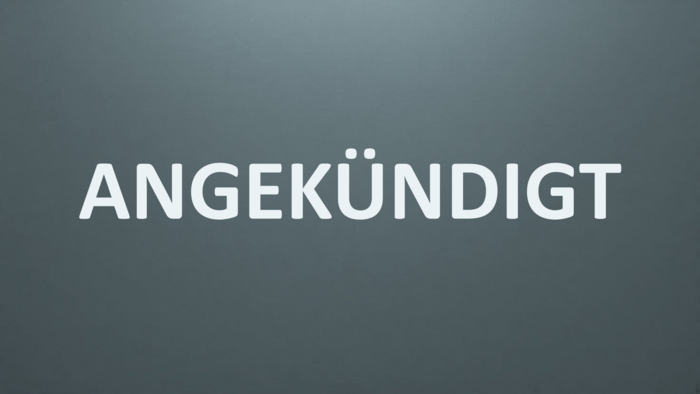
Erfolgsindikatoren Gesetzgebung
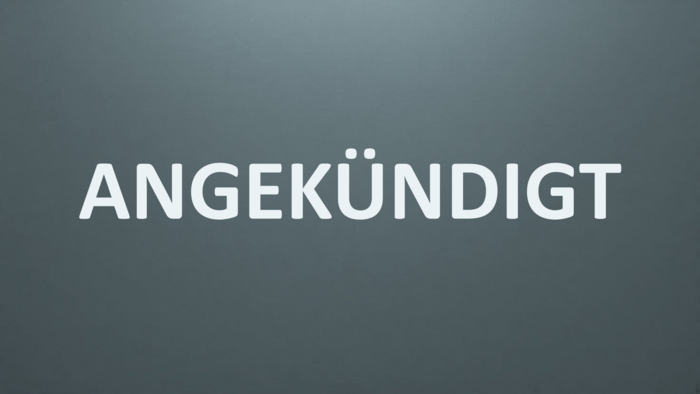
Zuständigkeit Bundeskanzleramt
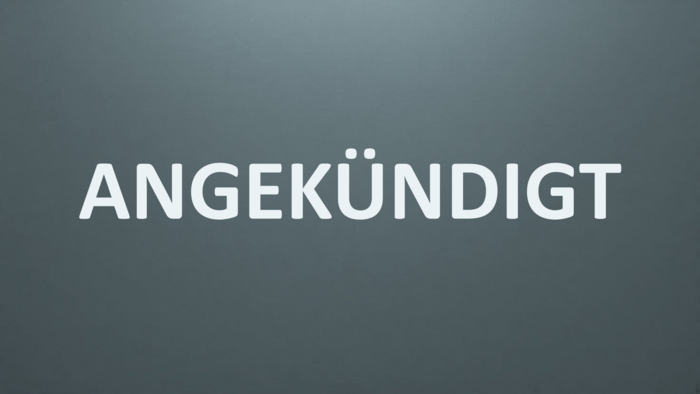
Schaffung eines digitalen Bürokratieportals
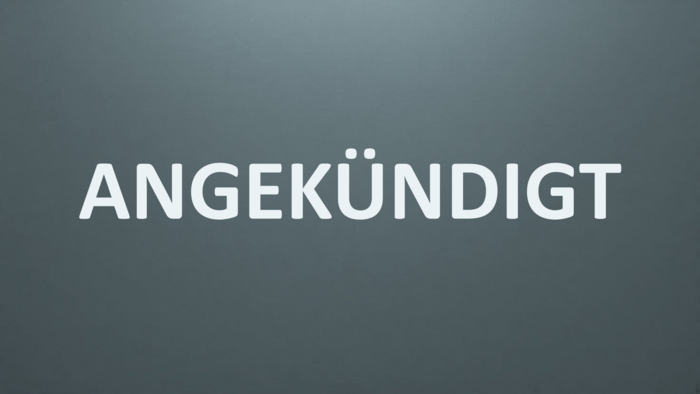
Keine bürokratische Übererfüllung
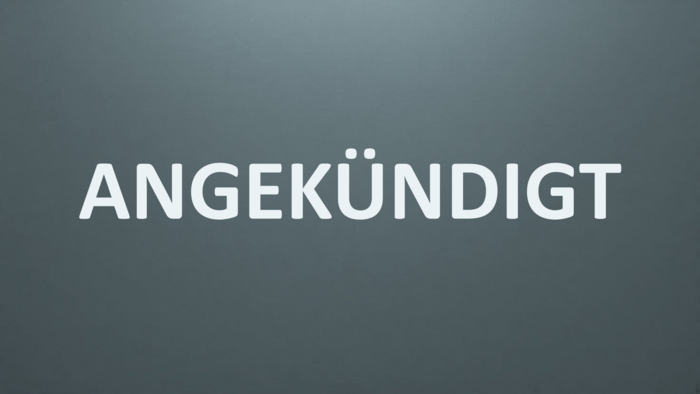
Bürokratierückbaugesetz Ehrenamt
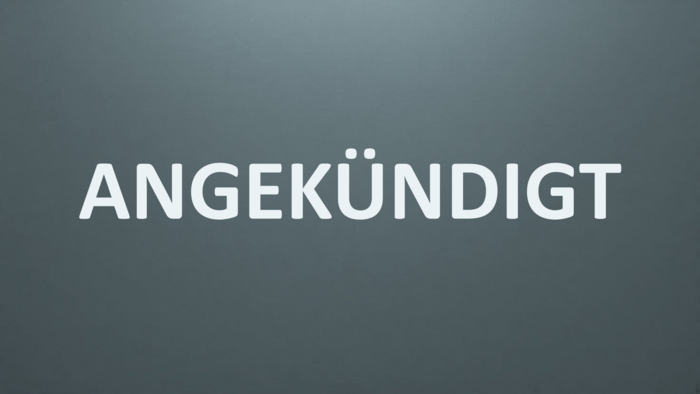
Bürokratie neu denken. Freiräume schaffen.
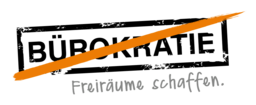
Gerade kleine Betriebe sind überproportional von Bürokratie betroffen. In vielen Fällen müssen sie identische Anforderungen wie Großunternehmen erfüllen, ohne auch nur annähernd vergleichbare Ressourcen zu haben. Die Vielzahl an Dokumentations- und Berichtspflichten ist dabei ein besonders großes Problem.
Der ZDH ermittelt die bürokratische Belastung von Betrieben und Beschäftigten im Handwerk und setzt sich mit konkreten Vorschlägen dafür ein, Bürokratie auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, um betriebliche Freiräume zu schaffen.
Ein Beispiel dafür ist das Maßnahmenpapier “Bürokratie neu denken. Freiräume schaffen.”